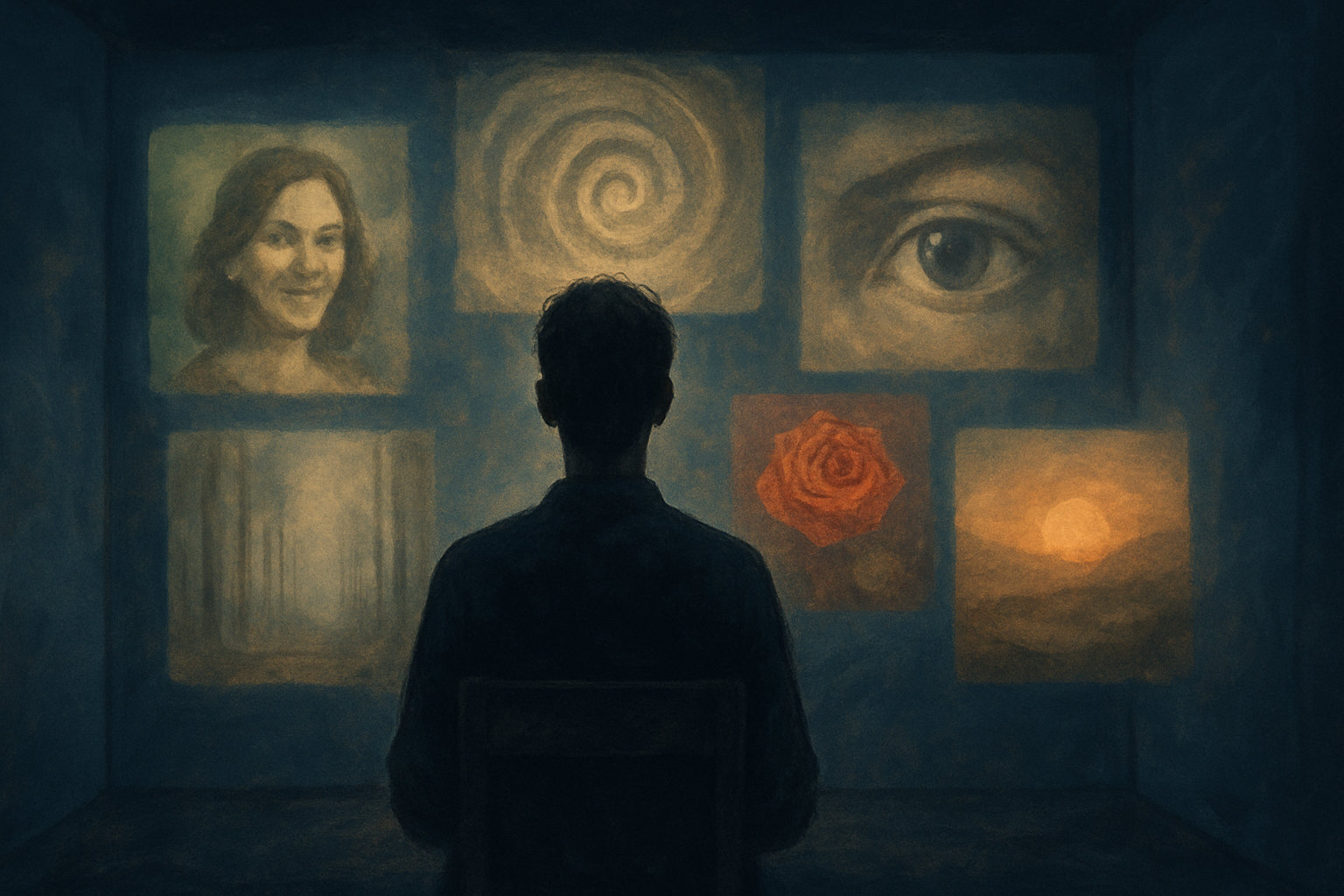4. Die Entstehung des Selbst: Default Mode Network, Selbstmodell, Sprache und Erinnerung
Mit jedem Wahrnehmungsakt scheint auch automatisch ein „Wahrnehmer“ aufzutauchen: Ich sehe den Sonnenuntergang, mir gefällt er, mein Herz geht dabei auf. Dieses subtile Gefühl eines zentralen Ich, das erfährt und bewertet, ist allgegenwärtig. Aus buddhistischer Sicht wird dieses Empfinden als Teil der Illusion eines Selbst analysiert. Es ist eine konstruierte Geschichte, die der Geist über die fünf Daseinsgruppen stülpt, manifestiert in Gedanken wie „Ich bin dies, mir gehört das, ich erlebe jenes“. Die moderne Neurowissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten ein Hirnnetzwerk identifiziert, das offenbar eng mit diesem Selbst-Gefühl verbunden ist: das Default Mode Network (DMN), oft als Standardnetzwerk oder Ruhemodus-Netzwerk übersetzt.
Das DMN besteht aus mehreren Gehirnregionen, vor allem dem medialen Präfrontalcortex (mPFC) und dem posterioren Cingulum (PCC) sowie angrenzenden Arealen. Interessanterweise ist dieses Netzwerk am aktivsten, wenn wir nach innen gerichtet sind und keiner konkreten Aufgabe nachgehen – beispielsweise beim Tagträumen, Grübeln oder Nachdenken über uns selbst. Man nennt es „Default Mode“ (Standardmodus), weil es der Geisteszustand ist, in den wir automatisch zurückfallen, wenn wir nicht gerade mit einer externen Aufgabe beschäftigt sind. Neuropsychologen beschreiben es bildhaft als die „Hinterbühne des Geistes“, auf der innere Dialoge, Erinnerungen und Zukunftspläne ablaufen. Tatsächlich zeigen Studien, dass das DMN aktiv ist, wenn Menschen an ihre Vergangenheit denken, Zukunftsszenarien durchspielen oder über sich selbst nachsinnen. Es ist also eng mit der narrativen Selbstmodellierung verknüpft – der Fähigkeit, sich selbst in der Zeit zu verorten und eine zusammenhängende Geschichte von „mir und meinem Leben“ zu konstruieren.
Man könnte sagen, das DMN ist das neuronale Korrelat des Ego-Schriftstellers in uns. Hier werden Informationen aus dem Gedächtnis (der PCC ist mit dem autobiographischen Gedächtnis verbunden) und aus Bewertungszentren (der mPFC ordnet Dinge in Bezug auf mich ein) verknüpft, um ein kohärentes Bild von „mir“ zu schaffen. Wenn du etwa still dasitzt und die Gedanken schweifen lässt, bemerkst du vielleicht, dass sie oft um dich selbst kreisen: was du noch tun musst, was andere von dir halten, was dir Gutes oder Schlechtes widerfahren ist. Diese Art von Selbstreferentialität ist ein Kennzeichen des Default Mode. Eine bekannte Studie hat interessanterweise herausgefunden, dass Menschen in solchen unkonzentrierten Momenten häufiger unglücklich sind, selbst wenn die Gedanken neutral oder positiv sind. Ein Forscherteam titelte dazu: “A wandering mind is an unhappy mind” – ein abschweifender Geist ist ein unglücklicher Geist. Das abschweifende DMN korreliert also mit geringerer Zufriedenheit. Eine Hypothese dafür ist, dass wir uns im Default-Modus ständig mit Vergangenem und Zukünftigem beschäftigen, oft in sorgender oder ersehnender Weise, anstatt im gegenwärtigen Moment verankert zu sein.
Wie entsteht nun aus den Aktivitäten des DMN der Eindruck eines Ich? Die Neurowissenschaft erklärt dies durch die Integration von Erfahrung um einen Referenzpunkt. Der mPFC hilft uns beispielsweise, neue Erlebnisse daraufhin zu prüfen: „Was sagt das über mich? Wie fühle ich darüber?“. Auch die Sprache spielt eine wichtige Rolle: Indem wir innerlich formulieren „Ich fühle dies, mir ist das passiert“, erschaffen wir ein linguistisches Selbst. Unser Gehirn erzeugt konstant einen Selbstkommentar, einen inneren Erzähler. Entwicklungspsychologisch erlernen wir diesen erzählerischen Selbstblick in der Kindheit, unter anderem wenn Eltern mit uns über uns sprechen und so narrative Erinnerungen formen. Das Gedächtnis hält schließlich die Puzzleteile zusammen: Es liefert die Erinnerung an frühere „Ich-Momente“, und durch deren ständiges Reaktivieren entsteht das Gefühl eines kontinuierlichen Identitätskerns.
Der Buddhist würde sagen: Dieses Selbstgefühl ist letztlich ein Konstrukt ohne festen Kern. Es ist vergleichbar mit einer Flamme, die zwar sichtbar ist, aber nur eine schnelle Abfolge von Verbrennungsprozessen darstellt, ohne eine Substanz in sich selbst zu besitzen. Modern gesprochen hat das Gehirn ein Selbstmodell entworfen, weil es funktional nützlich ist, um Erfahrungen zu organisieren und in sozialer Interaktion konsistent aufzutreten. Doch dieses Modell ist nicht gleichbedeutend mit einer unveränderlichen, autonomen Entität. Es ist flexibel und an bestimmte Gehirnaktivitäten gebunden.
Ein faszinierendes Forschungsgebiet ist die Frage, was mit dem Selbstgefühl in tiefen Meditationen geschieht. Erfahrene Meditierende berichten, dass das gewöhnliche Ich-Gefühl vorübergehend verschwinden kann. Es bleibt dann ein klares Gewahrsein, aber ohne das Gefühl „Ich bin der Erfahrende“. Neurowissenschaftliche Studien unterstützen solche Berichte. Tatsächlich zeigen Gehirnscans, dass bei geübten Meditierenden das Default Mode Network deutlich ruhiger gestellt wird. In einer oft zitierten Studie von Brewer et al. (2011) fanden die Forscher heraus, dass während verschiedener Meditationsarten (wie Konzentration, Liebende Güte oder offenes Gewahrsein) die Hauptknoten des DMN – der mediale Präfrontal- und der posteriore Cingulärkortex – bei erfahrenen Meditierenden weniger aktiv waren als bei Kontrollpersonen. Gleichzeitig war die Verbindung zwischen dem PCC (dem Selbstreferenzzentrum) und frontalen Kontrollarealen stärker, was als höhere Selbstregulation interpretiert wird. Einfach gesagt: Die geübten Meditierenden verfielen weniger ins Tagträumen und egozentrische Denken. Stattdessen waren Hirnregionen, die für Gegenwärtigkeit und Beobachtung zuständig sind, aktiver gekoppelt. Dieses Ergebnis passt gut zu der Idee, dass Meditation das konstante „Geschichtenerzählen über mich“ beruhigt und dadurch das Selbstgefühl abschwächt. Ergänzend sei erwähnt, dass es Hinweise darauf gibt, dass selbst kurze Achtsamkeitsinterventionen bereits das sogenannte Mind-Wandering (Gedankenabschweifen) reduzieren und die Neigung mindern können, ständig um sich selbst zu kreisen.
Neben dem DMN gibt es natürlich weitere Aspekte des Selbst. Dazu gehören etwa das Körperschema (unsere Verkörperung, die im Gehirn z.B. im temporoparietalen Kortex mitrepräsentiert wird) oder das Ich als Handelnder (das Gefühl von Urheberschaft, verbunden mit Arealen wie der Insula und dem supplementär-motorischen Feld). All dies zusammen wird im Dharma jedoch unter dem Begriff für Geist-Körper – und eben den fünf Aggregaten – verortet. Wichtig ist festzuhalten: Sowohl der Buddhismus als auch die Wissenschaft kommen zu dem Schluss, dass das Gefühl eines einheitlichen Selbst eher ein Nebenprodukt verschiedenster Prozesse ist als eine feste, unabhängige Entität. Es ist entstanden und entsteht im Moment immer wieder neu. Genau deshalb kann es auch verändert oder aufgelöst werden. Diese Aussicht mag zunächst verunsichern – wer will schon „Ich-Losigkeit“ erfahren? Doch hier liegt ein großes Potenzial für Freiheit, wie wir noch sehen werden.
Bevor wir zur praktischen Arbeit mit Wahrnehmung und Selbst kommen, betrachten wir, wie Achtsamkeit diese beschriebenen Wahrnehmungsprozesse beeinflusst – sowohl subjektiv erfahrbar als auch messbar im Gehirn.
graph TD
subgraph DMN_Gehirn ["Default Mode Network (DMN)"]
direction TB
DMN_Node1["<b>Medialer Präfrontalcortex (mPFC)</b><br/>Selbstbezogenes Denken<br/>Bewertung in Bezug auf 'Mich'<br/>Zukunftsplanung"]
DMN_Node2["<b>Posteriorer Cingulärer Cortex (PCC)</b><br/>Autobiographisches Gedächtnis<br/>Integration von Informationen<br/>Selbstwahrnehmung"]
DMN_Node3["Weitere assoziierte Regionen<br/>(z.B. Teile des Temporallappens,<br/>Hippocampus)"]
DMN_Node1 --- DMN_Node2 --- DMN_Node3
end
DMN_Gehirn -- "Aktiv bei" --> A["<b>Innerlich fokussierten Zuständen</b><br/>(Wenn nicht auf externe Aufgabe konzentriert)"]
A -- "Führt zu typischen Aktivitäten" --> B["Tagträumen<br/>Grübeln<br/>Nachdenken über sich selbst<br/>Erinnern der Vergangenheit<br/>Planen der Zukunft"]
B -- "Trägt bei zur" --> C{"<b>Narrativen Selbstkonstruktion</b><br/>(Erschaffung einer kohärenten 'Ich-Geschichte')"}
subgraph Komponenten_Selbstgeschichte ["Komponenten 'Ich-Geschichte'"]
direction TB
C1["Autobiographische Erinnerungen<br/>(Was 'mir' passiert ist)"] -->
C2["Selbstbewertungen & Überzeugungen<br/>('Ich bin so und so')"] -->
C3["Emotionale Verknüpfungen"] -->
C4["Sprachliche Formulierung<br/>(Innerer Erzähler: '<i>Ich</i> fühle', '<i>Mir</i> geschah')"]
end
C4 --> C_LinkTarget["Narrative Selbstkonstruktion"]
C_LinkTarget -.- C
C --> D["<b>Erlebter Eindruck eines<br/>kontinuierlichen, kohärenten 'Selbst'</b>"]
style DMN_Gehirn fill:#e0f2f7,stroke:#0077c2,stroke-width:2px
style DMN_Node1 fill:#ffffff,stroke:#0077c2,stroke-width:1px
style DMN_Node2 fill:#ffffff,stroke:#0077c2,stroke-width:1px
style DMN_Node3 fill:#ffffff,stroke:#0077c2,stroke-width:1px
style C_LinkTarget fill:none,stroke:none,color:none
style A fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px
style B fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:1px
style C fill:#c8e6c9,stroke:#388e3c,stroke-width:2px
style Komponenten_Selbstgeschichte fill:#f1f8e9,stroke:#7cb342,stroke-width:1px
style C1 fill:#ffffff,stroke:#7cb342,stroke-width:1px
style C2 fill:#ffffff,stroke:#7cb342,stroke-width:1px
style C3 fill:#ffffff,stroke:#7cb342,stroke-width:1px
style C4 fill:#ffffff,stroke:#7cb342,stroke-width:1px
style D fill:#ffcdd2,stroke:#c62828,stroke-width:2px
Schlüsselbegriffe aus dem Pāli in diesem Kapitel:
- Nāma-Rūpa: Wörtlich „Name-Form“ oder „Geist-Körper“; ein zentraler Begriff, der die psycho-physische Einheit des Individuums beschreibt, bestehend aus den mentalen Komponenten (Nāma: Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen, Bewusstsein) und der körperlichen Komponente (Rūpa: Form, Materie). Die fünf Aggregate (Khandhas) sind eine detailliertere Analyse von Nāma-Rūpa.